Konzeption der „Freien Orthodoxie“
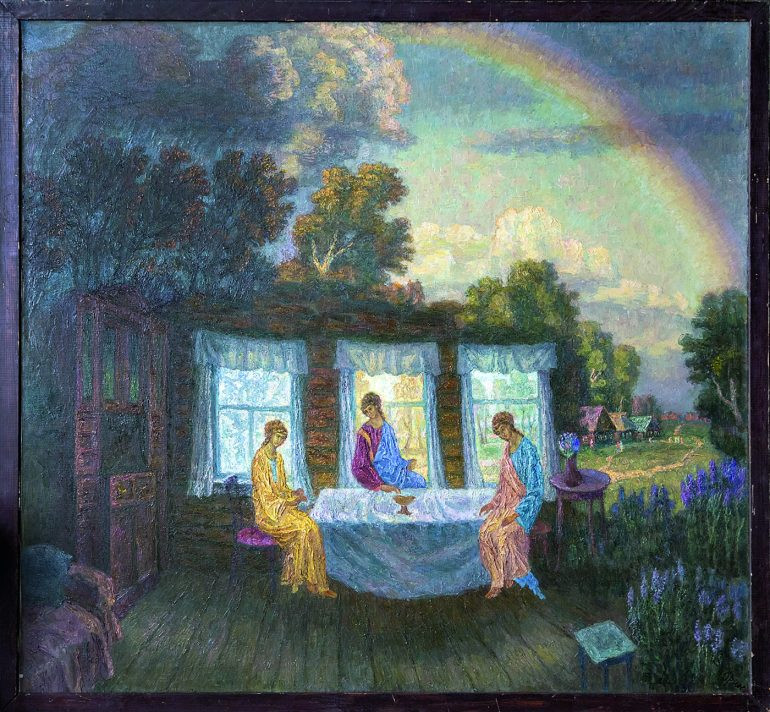
Konzeption der „Freien Orthodoxie“
Igor Manannikov
Kandidat der Philosophiewissenschaften (PhD), Priester, Apostolische Orthodoxe Kirche, Berlin, Deutschland
Mein Ziel ist der Versuch, einen Blickwinkel auf die orthodoxe Tradition zu finden, der es erlaubt, die befreiende Natur des orthodoxen Glaubens und Lebens zu sehen und – möglicherweise – praktisch zu verwirklichen. Ich verstehe, dass eine derart allgemeine Darstellung in den Details angreifbar ist; ohne diesen Rahmen würden wir jedoch in Einzelheiten versinken und das größere Bild verfehlen, das ich zu skizzieren versuche.
1.
Gewöhnlich bezeichnet man mit „Orthodoxie“ eine der christlichen Konfessionen neben Protestantismus und Katholizismus. Doch bereits die Bezeichnung der Kirche als „Orthodoxie“ ist – wenn auch alt – ein religionswissenschaftlicher Terminus, den die Kirchenväter verwendeten, um die wahre Kirche von häretischen Versammlungen abzugrenzen. „Orthodoxie“ ist ein leerer Terminus; er gewinnt Sinn nur im Gegensatz zu Begriffen wie „nicht-orthodox“ oder „häretisch“. Es ist ein beschreibender, vor allem polemischer Begriff, der wenig über den Inhalt aussagt und Sinn primär in der Polemik entfaltet. Wesensmäßig ist die Orthodoxie die Kirche als solche.
2.
Das, was wir „Orthodoxie“ nennen, ist schlicht Christentum, in dem gegenwärtig eine byzantinische Ästhetik und ein byzantinisches kanonisches Recht vorherrschen. Dogmatische Theologen versuchen uns zu überzeugen, die Orthodoxie sei eine bestimmte Art von Dogmatik; die Geschichte zeigt jedoch, dass innerhalb der Orthodoxie früher und heute unterschiedliche theologische Theorien koexistierten und koexistieren. Rückblickend sehen wir zudem, dass einige Lehren, die im 2. Jahrhundert als orthodox galten, im 4. Jahrhundert als häretisch beurteilt wurden (etwa der Subordinatianismus der Apologeten Tertullian und Justin der Märtyrer oder der Chiliasmus des Irenäus). Christliches Denken entwickelt sich also. In der ästhetischen und kanonischen Sphäre beobachten wir diese Entwicklung jedoch kaum; byzantinische Ästhetik und Kanones bleiben weitgehend unverändert. Damit erscheinen sie als eine Art „Invariante“ der Orthodoxie. Fragt man heute einen gewöhnlichen Menschen, was Orthodoxie sei, nennt er meist Dinge der Ästhetik oder der kanonischen Ordnung. Das bestätigen misslungene Experimente mit dem westlichen Ritus in der Orthodoxie sowie der gescheiterte Dialog mit Anglikanern und Altkatholiken. Dogmatik kann übereinstimmen; doch ein bartloser Priester, ein nicht-byzantinisches Kircheninterieur oder gar ein verheirateter Bischof hindern viele Gläubige daran, eine Gemeinde als orthodox zu identifizieren. Ich definiere daher Orthodoxie als Christentum mit einem hypertrophierten byzantinisch‑ästhetischen und kanonischen Element. Kirchen, die dieses Element gegen Veränderungen bewahren, nenne ich „kanonische Orthodoxie“. Dies ist natürlich ein Arbeitsbegriff, der weiterer Präzisierung bedarf.
3.
Der Terminus „Freie Orthodoxie“ gewinnt seinen präzisen Sinn in der Gegenüberstellung zur kanonischen Orthodoxie. Die Freie Orthodoxie sanktioniert bzw. ermöglicht Entwicklung in der Sphäre der Kanones und der Ästhetik – dort, wo die kanonische Orthodoxie Unveränderlichkeit wahrt.
4.
Kann man die Freie Orthodoxie eine „orthodoxe Reformation“ nennen? Nein. Ich rufe nicht dazu auf, etwas zu reformieren, abzuschaffen oder neue Regelungen, Kanones und Stile autoritativ einzuführen. Ich rufe zu einem freien, variablen Umgang mit diesen Dingen auf – denn gerade dieser Zugang ist im Grunde der wirklich traditionelle.
5.
Meines Erachtens umfasst der Begriff „Tradition“ nicht nur die Weitergabe vergangener Erfahrungen und Inhalte (der „Content“ des Überlieferungsgutes), sondern ebenso deren Verstehen und Aneignung durch Zeitgenossen. Hauptakteur der Traditionsweitergabe ist folglich der jeweilige Gegenwartsmensch, der die Tradition erbt – was bedeutet, dass er sie in seinen Lebensumständen anwendet, ihren Wert versteht und anerkennt. Daher ist der entscheidende Moment der Traditionsannahme die Kritik. Mechanisches, unkritisches Wiederholen ist kein Begreifen und keine Aneignung der Tradition, sondern nur eine Imitation, eher einem Cargo-Kult ähnlich als einem echten „Durchleben“ der Tradition. Ein Beispiel: Nehmen wir an, wir erben von der Großmutter einen großen Kleiderschrank. Wir räumen ihn aus: manches Veraltete kommt weg, anderes wollen wir tragen. Auch hier sortieren wir – Sommer- und Wintersachen. Das ist kritische Aneignung: Erst die Kritik macht die Dinge für uns wirklich; sie bezieht das Vorgefundene auf unsere personale Realität und Geschichte und macht es zu einem Teil unserer Erfahrung. Die kanonische Orthodoxie hingegen zieht in scheuer Ehrfurcht „alles“ an, zieht alle Kleider an und verschiebt es in die symbolische Ebene. Auch dort findet freilich eine Ausscheidung statt – aber heimlich und beschämt.
6.
In der Kirchengeschichte finden wir zwei Haltungen zur christlichen Tradition: die Reformation und das Zweite Vatikanische Konzil. Die Reformation trennte sich von einem Großteil die Heilige Überlieferung, ließ den kritischen Subjektstandpunkt und die formalisierten Teile des Überlieferungsgutes – die Heilige Schrift – stehen. Das Zweite Vatikanum bewahrte die Heilige Überlieferung, führte die Änderungen (neue Dogmen) jedoch direktiv und zentralisiert ein. Die Freie Orthodoxie vermeidet meines Erachtens diese Extreme: Sie bewahrt den traditionellen Inhalt, überlässt es aber den Gläubigen oder Gemeinden, ohne äußeren Zwang zu entscheiden, ob sie ihn für ihre geistlichen Bedürfnisse verwenden – oder etwas Neues schaffen.
7.
Die ästhetische Komponente der Orthodoxie kann man begabten orthodoxen Künstlern, Musikern und Liturgikern überlassen, die dafür eine schöpferische Berufung haben. Die Früchte ihrer Arbeit werden durch ihre Popularität im Volk und ihre Lebensdauer beurteilt. Persönlich sehe ich derzeit keine Alternative zur Liturgie des heiligen Johannes Chrysostomos. Zugleich sehe ich keine Hindernisse, andere Gottesdienstformen zu verfassen und lokal einzuführen. Kommen wir nun zu den Kanones.
8.
Die kirchlichen Kanones werden in der kanonischen Orthodoxie als Rechtssystem missverstanden – nämlich nach dem Vorbild des römischen Rechts als gesetzgeberische Normen. Tatsächlich entsprechen sie eher dem angelsächsischen Präzedenzrecht (Common Law). Rechtsquelle ist hier der Präzedenzfall, also die Entscheidung zu einem konkreten Streit. Der Kanon ist somit ein Beispiel einer Lösung für eine konkrete Situation und keine abstrakte Norm für standardisierte Anleitungen. Wir alle kennen kuriose amerikanische Gesetze wie: In Missouri ist es verboten, einem Elefanten Bier zu geben; in Michigan darf man keine Kraken auf Menschen werfen; in Massachusetts sind Patronen kein zulässiges Zahlungsmittel. Solche Regeln beruhen auf Präzedenzfällen: Irgendwann gab es entsprechende Situationen, die Streit auslösten und eine Regelung verlangten. Später änderte sich die Lage, und die Regeln verloren an Relevanz. Ähnlich bei den kirchlichen Kanones: Sie lösten Probleme ihrer jeweiligen Zeit. Dafür tagten alle zwei Jahre Lokalsynoden (dieser Kanon wird heute übrigens nicht erfüllt), um aktuelle Probleme mit aktuellen Kanones zu entscheiden. So verbietet z. B. der 83. Kanon des Trullanischen Konzils verbietet, den Toten die heilige Kommunion zu spenden – offenbar kam damals jemand auf diese Idee. Heute ist das für uns nicht relevant. Es gibt viele derartige Kanones. Das alles bedeutet: Kanones sind Präzedenzfälle, keine generellen Normtexte. Ein Kanon kann daher je nach realer Situation hilfreiche Orientierung bieten – oder je nach der tatsächlichen Situation nutzlos sein. Das orthodoxe Kirchenrecht bedarf folglich keiner Reform, sondern des gesunden Menschenverstandes von Klerikern und Laien, die in jedem konkreten Fall die Anwendbarkeit eines Kanons erkennen. In komplexen Fällen kann man eine Lokalsynode zur Entscheidung einberufen.
Über die Macht
Die Kanones prägen auch die Machtstruktur der Orthodoxie. Das gegenwärtige hierarchische System – einschließlich der Patriarchate und Autokephalien – überträgt die imperial‑byzantinische Machtstruktur in den kirchlichen Raum. Die Kirche hat Organisations- und Expansionslogiken der Imperien übernommen (Expansion ist der Struktur inhärent) und Kolonialismus irrtümlich für Mission gehalten. Kirchlicher Kolonialismus ist zusammen mit dem imperialen Kolonialismus in die Kirche eingedrungen und zur Gewohnheit geworden. Die im 3. Jahrhundert bestehende Konföderation freier Kirchen verwandelte sich nach der staatlichen Anerkennung der Kirche (in 4. Jahrhundert) etwas wie Systeme der staatlichen Provinzen oder römischen Provinzen und Municipios. Damit wird die direkte Weisung Christi verletzt: „Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch soll es nicht so sein; wer unter euch groß sein will, sei euer Diener; und wer unter euch der Erste sein will, sei euer Knecht“ (Mt 20,25–27). Die falsche Idee eines kirchlichen Imperiums verwirklichte sich im Katholizismus am stärksten, existiert aber in der Orthodoxie verdeckt in Form der Patriarchate und der Figur des Patriarchen. Vom Streit der Patriarchate um den Primat ganz zu schweigen – er widerspricht dem Geist des Christentums. An die Stelle eines Papstes setzt die kanonische Orthodoxie einen „kollektiven Papst“ – das „Ökumenische Konzil“. Warum suchen wir fortwährend sichtbare Autorität? Woher das Verlangen nach Herrschaft über uns? Das erinnert an 1 Sam 8: Israel verlangt von Samuel einen König, „wie alle Völker“. Samuel aber wehrt ab und sagt: Euer König ist Gott – eines anderen bedarf es nicht.
In der globalisierten Gegenwart hat das System der Patriarchate meines Erachtens seine Aktualität verloren. Wie entstanden die Patriarchate? Es war eine einfache Hochskalierung der Eparchie: Eparchien wurden unter den Häuptern der Metropolien zusammengefasst, diese wiederum unter einem Patriarchen. Die automatische Skalierung der kirchlichen Gemeinschaft – von der Hausgruppe bis zur vieltausendköpfigen Metropole – ist unangebracht. Sie kopiert die Struktur des Armee und anderer weltlicher Organisationen und taugt der Kirche nicht als Vorbild. In einer solchen unpersönlichen Organisation verschwinden persönliche Beziehungen und die Liebe.
Als zulässiges und wünschenswertes Modell der kirchlichen Gemeinschaft erscheint die Familie. Nicht zufällig beginnt unser Hauptgebet mit „Vater unser“ und unser ganzes theologisches Denken operiert mit familialen Begriffen. Eine vieltausendköpfige Familie ist undenkbar; die Vielzahl führt unvermeidlich zur Objektivierung der Mitglieder und zur Wahrnehmung von Macht als Gewalt. Machtbeziehungen (sofern überhaupt anwendbar) können daher nur in der kleinen Gemeinde existieren, in der die Macht des Bischofs nicht als objektivierte Gewalt, sondern als väterliche Ermahnung verstanden wird.
10.
Dementsprechend ist die Rolle des Bischofs wichtig. Das episkopale Organisationssystem scheint mir richtig und vorzugswürdig. Der Bischof ist jedoch kein Verwaltungsbeamter, sondern geistlicher Hirt. Da der Hirt „seine Schafe kennt“ (Joh 10,14), kann die Gemeinde nicht so groß sein, dass der Hirt reale Bindungen zu den Anvertrauten verliert. Darum kann der Bischof nur in einer kleinen Gemeinschaft wirken. In der heutigen Praxis übernehmen oft die Pfarrer der Gemeinde die Rolle des Bischofs. Nur die Angst des Patriarchen und der Metropoliten vor Kontrollverlust in der heutigen Hierarchie hindert daran, solche Vorsteher zu Bischöfen zu machen – obwohl dies dringend nötig wäre. Es sollte viele Bischöfe geben. Jede Kleinstadt sollte ihren Bischof haben, in Metropolen jeder Bezirk. Neben dem seelsorglichen Gewinn würde dies Macht streuen und den Machtkampf in der Kirche eindämmen. Zudem fördert die Vielzahl der Eparchien die Mission. Die Eparchie sollte vom rein territorialen Prinzip gelöst und um weitere Dimensionen ergänzt werden. Eine bloß territoriale Gliederung genügt in der globalisierten Welt nicht. Zusätzliche Parameter wie Sprache, Nationalität, soziale Schichten u. a. sind nötig. Es ist völlig normal, dass in einer Stadt mehrere Bischöfe tätig sind und unterschiedliche Zielgruppen erreichen. Heute hat jede große europäische Stadt mehrere soziale, oft nicht überschneidende Milieus. So kann es in einer Stadt mehrere Diasporas mit unterschiedlichen Sprachen geben. Natürlich ist es sinnvoll, dass jede Gruppe ihren eigenen Bischof hat, der ihre Sprache spricht und ihre Lebenslage versteht. Das ist die Umsetzung der Apostolizität „zu den Sprachen“: Die Apostel predigten Völkern, also Menschen mit bestimmter Kultur. Ihr Ziel war der Mensch – nicht ein Territorium, das man zur „christlichen Zone“ erklären konnte. Zur Zeit der Apostel fiel das Territorium oft mit Sprache und Volk zusammen. Das ist jetzt nicht so. Heute ist es nur ein geographischer Punkt ohne kirchliche Bedeutung. Es ist längst normal, dass es in Berlin eine syrische Gemeinde mit syrischem Bischof gibt, während im Nachbarbezirk ein serbischer Bischof seine serbische Gemeinde auf Serbisch betreut. Diese Überlagerung von Eparchien wird in Zukunft zunehmen – je früher wir das begreifen, desto besser.
11.
Die Freie Orthodoxie ist somit ein natürlicher und folgerichtiger Ausweg aus der Krise, die die kanonische Orthodoxie zerreißt. Die Freie Orthodoxie ist keine Utopie; sie wird seit vielen Jahren im sogenannten „alternativen Orthodoxentum“ realisiert. Dieses wird von der kanonischen Orthodoxie in Misskredit gebracht, weil es deren Monopol auf Orthodoxie in Frage stellt. Die Freie Orthodoxie ist keine konkrete Kirchenorganisation, sondern ein Ansatz, die Kirche als befreiende geistliche Wirklichkeit zu verstehen – nicht als versklavende christliche Ideologie. Sie ist nicht notwendig mit liberaler Theologie und Praxis verbunden. Gemeinden können sehr strenge und asketische Lebensformen wählen. Freiheit setzt die freie Wahl der christlichen Lebensform voraus, die unterschiedliche Ausdrucksweisen innerhalb des Hauptgebotes der Liebe haben kann.
Berlin, 03.10.2022
